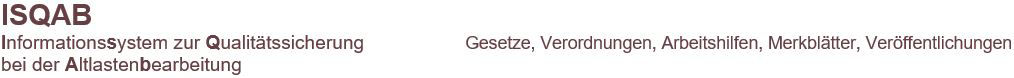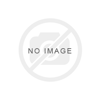Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Basis-Infos
Nach Attributen filtern
- Anwendungsempfehlung
- Bundesrepublik Deutschland (DE)
- Baden-Württemberg (BW)
- Bayern (BY)
- Niedersachsen (NI)
- Schleswig-Holstein (SH)
- Wirkungspfad
- Boden - Mensch
- Boden - Nutzpflanze
- Boden - Grundwasser
- Medien
- Boden
- Grundwasser
PFC-Einträge in Böden durch Kompost und Klärschlamm
Die seit 2013 bekannten PFC-Belastungen von Äckern in Mittel- und Nordbaden wurden vermutlich durch Papierschlämme in Zusammenhang mit der Kompostausbringung verursacht. Um einen größeren Überblick über die mögliche Belastungssituation auf Ackerflächen zu erhalten, die in der Vergangenheit mit Kompost gedüngt wurden, hat die LUBW im Jahr 2015 landesweit Stichproben von Böden entnommen und auf Belastungen mit 20 verschiedenen per- und polyfluorierten Verbindungen (PFC) untersucht. PFC-Belastungen wie in Mittel- und Nordbaden wurden nicht gefunden. Die Ergebnisse weisen daher auf einen sehr geringen flächigen, wahrscheinlich depositionsbedingten Hintergrundgehalt an PFC in Böden hin. Ergänzend wurden 2016 Stichproben von Ackerflächen im Land auf PFC untersucht, auf denen in den vergangenen Jahren Klärschlamm ausgebracht wurde. Auch dort wurden nur sehr geringe Hintergrundgehalte an PFC gemessen.
Position des FBU zu Grundsätzen der Bodenprobenahme im bodenschutzrechtlich geregelten Bereich
Statistische Modellierung von Gleichwertigkeitsuntersuchungen im Rahmen des Bundes-Bodenschutzgesetzes anhand von unterschiedlichen Messverfahren anorganischer und organischer Schadstoffparameter
Programm ElKriBaG-x zu GeoBerichte 22 Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden
Für die einfache und schnelle Anwendung der Arbeitshilfe in der Praxis kann das Excel-Programm ElKriBaG-x (Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden mit Excel) benutzt werden. Das Programm ermöglicht eine automatisierte Berechnung der Prüfkriterien Gefahrenschwelle/Schadensschwelle und Maßnahmenschwelle mit Hilfe der in den relevanten Kontrollebenen definierten Stromröhren. Die Arbeitshilfe GeoBerichte 22 enthält im Anhang 3 vier detailliert erläuterte Fallbeispiele, die mit ElKriBaG-x berechnet wurden.
Sachstandsbericht: PFAS - in Böden von Bodendauerbeobachtungsflächen
Untersuchungen der LUBW 2016 an Bodendauerbeobachtungsflächen in Baden-Württemberg erbrachten erste Hinweise auf messbare PFAS-Gehalte in wässrigen Eluaten von Hintergrundböden. Die Untersuchungen wurden im Zeitraum 2016 - 2020 fortgeschrieben. Es zeigt sich, dass PFAS in Oberböden von Bodendauerbeobachtungsflächen mehr oder weniger flächendeckend in sehr geringen Konzentrationen in den Eluaten nachgewiesen werden können.
Sanierungsmanagement für lokale und flächenhafte PFAS-Kontaminationen
Die vorliegende Arbeitshilfe unterstützt vollzugstauglich die zuständigen Behörden bei der Vorauswahl, der Bewertung und der Entscheidung für ein geeignetes und verhältnismäßiges Sanierungsverfahren, zeigt relevante Rahmenbedingungen und flankierende Maßnahmen auf.
Sanierungspläne im Flächenrecycling - Ein Instrument für die Bauleitplanung
Nach der Gesetzesbegründung zum BBodSchG soll der Sanierungsplan das zu realisierende Sanierungskonzept prüffähig darstellen und die erforderlichen Angaben und Unterlagen auch für mit eingeschlossene behördliche Entscheidungen enthalten.
Seminarunterlagen zum Programm ElKriBaG-x zu GeoBerichte 22 Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden
Seminarunterlagen für die Anwendung des Excel-Programms ElKriBaG-x (Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden mit Excel) Das Programm ermöglicht eine automatisierte Berechnung der Prüfkriterien Gefahrenschwelle/Schadensschwelle und Maßnahmenschwelle mit Hilfe der in den relevanten Kontrollebenen definierten Stromröhren. Die Arbeitshilfe GeoBerichte 22 enthält im Anhang 3 vier detailliert erläuterte Fallbeispiele, die mit ElKriBaG-x berechnet wurden.
Sorptions- und Transferverhalten von PFAA und ausgewählter Präkursoren im Wirkungspfad Boden-Pflanze für die Gefahrenabschätzung und –bewertung von PFC-Kontaminationen
Hintergrund des Forschungsprojektes PROSPeCT ist der Schadensfall in Baden-Württemberg bei dem hunderte Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche durch mit Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) enthaltene Papierschlämme kontaminiert wurden und zu Belastungen mit PFAS von Boden, Nutzpflanzen und Grundwasser führte. PROSPeCT hatte zum Ziel den Kenntnisstand zum Umweltverhalten von PFAS im Pfad Boden-Wasser-(Mais-)Pflanze zum einen zu erweitern und zum anderen mittels eines Modellierungsansatzes abzubilden. Die in den Papierschlämmen vorhandenen Präkursoren, vor allem diPAPs, wurden hinsichtlich ihres Abbauverhaltens zu mobilen PFAAs, die in Grundwasser und Pflanzen eingetragen werden, untersucht. In fünf Arbeitspaketen, welche die Projektorganisation (AP 1), die experimentellen Versuche (AP 2 und 3), die Analytik (AP 4) und die Modellierung (AP 5) umfassten, wurde die Problematik ganzheitlich bearbeitet.
Statistische Modellierung von Gleichwertigkeitsuntersuchungen im Rahmen des Bundesbodenschutzgesetzes anhand von unterschiedlichen Messverfahren anorganischer und organischer Schadstoffparameter
Das Ziel einer Äquivalenzprüfung besteht in dem Nachweis, dass sich die zu prüfende Methode von der Referenzverfahren nur in einem geringem, zu tolerierenden Ausmaß unterscheidet. Diese Bemessung erfolgt anhand von Validierungskriterien wie Wiederfindungsrate, Vergleich- und Wiederholstandardabweichung. Die statistische Grundlage dieser Bemessung ist ein Modell der Messunsicherheit. Dadurch kann gewährleistet werden, dass sich die Messunsicherheit auch nach Einführung äquivalenter Methoden nicht oder nicht wesentlich erhöht.
Stellungnahme des FBU zum Einsatz von Verfahren der Vor-Ort-Analytik im Anwendungsbereich der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
Die VOA kann qualitative Aussagen zu den enthaltenen Stoffen sowie halbquantitative oder unter bestimmten Umständen auch quantitative Ergebnisse der Stoffgehalte (in Böden) liefern. Die VOA ist idealtypisch geeignet, auf einer Fläche die Konzentrationsverteilung zu beschreiben und damit die Eckpunkte für eine weitergehende Untersuchung festzulegen. Dies ist der in der BBodSchV beschriebene Anwendungsbereich.
Studie zur Aussagekraft des Total Oxidizable Precursor-Assays (TOP-Assay) von methanolischen Bodenextrakten und wässrigen Eluaten
Das Analysenprinzip des Total Oxidizable Precursors(TOP)-Assay erlangte in den letzten Jahren große Bedeutung zur summarischen Erfassung von derzeit ̶ mangels Verfügbarkeit von analytischen Standards ̶ nicht mit der Einzelstoffanalytik messbaren polyfluorierten Verbindungen, einer Teilmenge der PFAS. Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz als Screening-Verfahren insbesondere bei quellennahen Umweltkontaminationen von großem Vorteil ist, um PFAS-Gehalte in Umweltproben besser abschätzen zu können. Der Bericht stellt die Möglichkeiten und Grenzen der TOP-Assay-Methodik dar und bewertet die Aussagekraft der Informationen, die aus der Anwendung von TOP-Assay-Methoden im PFAS-Schadensfallgebiet Rastatt / Baden-Baden und einiger Hintergrundflächen des Landes Baden-Württemberg erhalten werden können und bezieht dabei die aktuelle wissenschaftliche Literatur mit ein.
Tabelle zur Methosa 3.0
Methodentabelle aus der Methosa 3.0 als Tabellenkalkulation zur schnellen Recherche und Filterung nach Parametern, Methoden und Verfahren. Diese Datei wird als Recherchetool bereitgestellt. Bei inhaltlichen Fragen sind die Angaben in der Methosa 3.0 (PDF-Datei) maßgeblich.
Überprüfung von Methoden des Anhanges 1 der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zur Beurteilung der Bodenqualität
Die für Bodenuntersuchungen festgelegten Verfahren sowie Anforderungen an eine repräsentative Probenahme, Probenbehandlung und Qualitätssicherung sind im Anhang I der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 dokumentiert. Die dokumentierten Untersuchungsverfahren stellen den damaligen Entwicklungsstand für die Untersuchung von Böden dar.
Umgang mit der Messunsicherheit bei der Überschreitung von Prüf- und Maßnahmenwerten für den Vollzug der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Bewertung von Messergebnissen im Hinblick auf eine Überschreitung von Prüf- und Maßnahmenwerten
Untersuchungen zum Vollzug und zur Weiterentwicklung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Teil 1 - Zusammenstellung und Bewertung von Extraktionsverfahren zur Beurteilung der Verfügbarkeit von Schadstoffen in Böden.
Vergleichende Bewertung der Verfahren und Methoden des Anhanges 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) mit aktuellen Fassungen
Innerhalb der letzten sechs Jahre seit dem Erscheinen der BBodSchV schritt die Entwicklung der Normierung für einige Verfahren und Methoden der BBodSchV stetig voran, so dass nun für eine Vielzahl der Normen, die bisher in der BBodSchV nur im Entwurf zitiert wurden, veröffentlichte Normen vorliegen. In der Regel konnte der FBU für diese Normen eine Empfehlung aussprechen.
Weiterentwicklung und Aktualisierung der Methodik zur Ermittlung der Ergebnisunsicherheit auf der Grundlage der durchgeführten Ringuntersuchungen für den Vollzug der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Im Vergleich zu den Empfehlungen des Fachbeirates Bodenuntersuchungen (FBU) von 2008, die auf pauschalen prozentualen Unsicherheiten basieren, konnte durch Anwendung einer additiven Varianzfunktion eine deutlich verbesserte Modellierung der Vergleichsstandardabweichung erzielt werden. Mit dem neu entwickelten Ansatz kann die analytische Unsicherheit als Teil der Ergebnisunsicherheit in Abhängigkeit des Feststoffgehaltes berechnet werden. Darüber hinaus konnten auch Empfehlungen für neue Parameter abgeleitet werden.
Weiterentwicklung von Kriterien zur Beurteilung des schadlosen und ordnungsgemäßen Einsatzes mineralischer Ersatzbaustoffe und Prüfung alternativer Wertevorschläge
Für alle geregelten mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) sind die neuesten Datengrundlagen, Statistiken und Begründungen für die Festlegung von Materialwerten und ggf. von Materialklassen zusammenfassend dargestellt.
Zielgerichtete Erhebung experimenteller Daten als Grundlage zur Ableitung der konzentrationsabhängigen Messunsicherheit bei Bodenelutionsverfahren
In der vorliegenden Studie sollte die konzentrationsabhängige Messunsicherheit von Bodenelutionsverfahren für mit organischen Substanzen belasteten Bodenmaterialien untersucht werden.
Zusammenstellung und Bewertung von Probennahmeverfahren für den vorsorgenden und nachsorgenden Bodenschutz sowie die Abschätzung der Messunsicherheit für die Probennahme
Bewertung von Probennahmeverfahren für den vorsorgenden und nachsorgenden Bodenschutz